Was tun mit diesen exotischen Bäumen?
Mehr Bäume Jetzt verteilt normalerweise heimische Baumarten. Diese finden wir am häufigsten im Überfluss an den Orten, an denen wir ernten. Gelegentlich retten wir auch nicht-heimische Arten, denen wir versuchen, einen guten Platz in der deutschen Landschaft zu geben. Wenn wir invasive Exoten ernten, lassen wir sie in Absprache mit dem Flächenbesitzer abtransportieren. Die Diskussion über die Pflanzung heimischer und nicht-heimischer Arten ist komplex und mit sehr unterschiedlichen Meinungen und Standpunkten verbunden. Auf dieser Seite geben wir zunächst einen Überblick über die laufende Debatte: Welche Begriffe sind wichtig? Welche Vor- und Nachteile sowie Risiken sind mit verschiedenen Arten verbunden? Zum Schluss erläutern wir unsere eigenen Überlegungen.
Das Ziel der Kampagne Mehr Bäume Jetzt ist das Pflanzen von mehr Bäumen und Sträuchern. Dadurch bremsen wir den Klimawandel, bieten echte Handlungsperspektiven und stärken die Artenvielfalt. Die Diskussion rund um heimisch-nicht-heimisch hat vor allem mit diesem letzten Punkt zu tun: der Stärkung der Artenvielfalt.
Artenvielfalt, oder Biodiversität bezieht sich auf die Vielfalt der Organismen (Pflanzen, Tiere, Pilze usw.) in einem Ökosystem (Laubwald, Dünengebiet usw.). Dabei geht es sowohl um die Vielfalt der Arten im Ökosystem als Ganzem als auch um die genetische Vielfalt innerhalb von Arten. All diese Organismen stehen in Beziehungen zueinander – Kooperation, Konkurrenz usw. – und erfüllen so jeweils eine wichtige Rolle.
Durch (Bio-)Diversität versucht das Leben insgesamt, also „die Natur“, sich gegen Krankheiten und Schädlinge, wechselnde (Klima-)Bedingungen, Verschmutzung und Störungen von außen (Feinstaub, Stickstoff, CO₂-Gehalte usw.) zu wappnen. Dank Biodiversität besteht eine größere Chance, dass es einzelne Arten gibt, die solche Störungen in einem Ökosystem „aufgreifen“ und als ihre Aufgabe übernehmen. Die eine Art gedeiht bei zusätzlichem Stickstoff, die andere verträgt mehr Feinstaub; ein Baum erkrankt an einem Bakterium, verbreitet sich aber nicht, weil direkt daneben eine Art steht, die dagegen resistent ist.
Im Allgemeinen gilt: Je komplexer und reicher die Vielfalt an Pflanzen, Tieren und anderen Organismen, desto gesünder ist das Ökosystem als Ganzes. Die „Produktion“ möglichst großer Biodiversität ist daher eine der wichtigsten Überlebensstrategien des Lebens auf der Erde. Umgekehrt gilt: Je weniger Biodiversität ein Ökosystem insgesamt aufweist, desto häufiger können Störungen nicht abgefangen werden, sodass letztlich immer mehr einzelne Arten aussterben.
Die Diskussion über heimisch und nicht-heimisch dreht sich stark um die Rolle, die Arten im Ökosystem spielen. Entscheidend ist, welche Verbindungen und welche Vielfalt sie hervorbringen – und damit, wie sehr sie zur Komplexität eines Ökosystems beitragen.
Arten: heimisch versus nicht-heimisch
Zunächst müssen wir klären, worüber wir reden. Wir beginnen mit Kategorien von Baumarten: heimisch, autochthon-heimisch und nicht-heimisch.
Heimisch
„Heimisch“ bezeichnet eine Art (Bäume, Sträucher, Pflanzen und Tiere), die „von Natur aus“ in Deutschland vorkommt. Diese Art ist nach der letzten Eiszeit von selbst hierher eingewandert und hat sich aus eigener Kraft angesiedelt, weil die klimatischen Bedingungen günstig waren. Spricht man von heimischen Arten, meint man heimisch in einer bestimmten „klimatischen Zone“, einem „natürlichen Verbreitungsgebiet“ oder einer „Ökoregion“ dieser Art. Solche Zonen halten sich nicht an Landesgrenzen: Was in den Deutschland heimisch ist, ist es oft auch in großen Teilen der Niederlande, Belgiens, des Vereinigten Königreichs, Frankreichs usw.
Autochthon-heimisch
„Autochthon” ist eine spezielle Form von heimisch. Alle autochthonen Bäume sind heimisch, aber nicht alle heimischen Bäume sind autochthon. Autochthone Pflanzen oder Tiere stammen von den natürlichen Populationen eines bestimmten Gebiets (in unserem Fall Deutschland) ab, die sich nach der letzten Eiszeit spontan hier angesiedelt und entwickelt haben. Besonders im Norden und Osten Deutschlands herrschte während der letzten Eiszeit ein arktisch-trockenes Klima. Die Landschaft war weitgehend baumlos und ähnelte einer polaren Wüste, in der nur kälteangepasste Gräser, Moose und Flechten überleben konnten. Die Vorfahren der autochthonen deutschen Bäume kehrten nach der Eiszeit allmählich aus wärmeren Gebieten zurück. Diese Populationen vermehrten sich weiter, entwickelten sich dort und sind daher langfristig an die deutschen Bedingungen und die heimische Artenvielfalt angepasst.
Mit anderen Worten: Autochthone Populationen stammen genetisch von Baumpopulationen ab, die sich schon seit Jahrhunderten in den Deutschland entwickeln konnten. Deshalb lassen sich in autochthonen Wäldern viele komplexe Symbiosen beobachten, und zahlreiche Arten (etwa Insekten und Pilze) leben auf diesen Bäumen und Sträuchern.
Durch die weitgehende Abholzung der Urwälder in Deutschland über viele Jahrhunderte sind heute nur noch wenige ursprünglich heimische Baum- und Straucharten in ihrer natürlichen Form erhalten. Meist erkennt man nicht, ob ein Baum autochthon ist. Aus historischen Quellen oder genetischen Untersuchungen lässt sich jedoch ableiten, wo autochthone Bäume stehen können. Einige Wälder sind erhalten, außerdem gibt es noch autochthone Exemplare in alten Hecken, Wallhecken und kleinen Gehölzen.In Deutschland sind weniger als 1 % der Wälder noch in einem naturnahen, ursprünglichen Zustand – ihre ursprünglichen Standorte sind heute fast vollständig verschwunden. Einige Flächeneigentümer und Forstbetriebe arbeiten gezielt mit autochthonen, lokal angepassten Baumpopulationen, um den Anteil naturnaher und widerstandsfähiger Wälder zu erhöhen.
Ein Beispiel: Was ist autochthon und was „nur“ heimisch?
Pflanzt du eine Buchecker aus Frankreich in deinen Garten, ist das daraus wachsende Bäumchen nicht autochthon. Diese Buche gehört zwar zur heimischen Art „Rotbuche“. Da autochthone und „importierte“ Buchen zur gleichen Art gehören, stimmen die meisten Eigenschaften überein. Daher können in der Regel alle Buchen nach der Pflanzung gut in den Deutschland gedeihen und erfüllen ungefähr dieselbe Rolle für heimische Insekten oder Pilze. Mitunter gibt es dennoch wichtige Unterschiede. So blühen Schlehen aus Südeuropa schon im März, wenn hier oft noch wenige Insekten aktiv sind. Eine autochthone Schlehe blüht im April, was für bestimmte Insekten besser ist.
Nicht-heimisch
Ein anderes Wort für nicht-heimisch ist „Exot“. Die Begriffe werden oft synonym verwendet. Nicht-heimische Arten / Exoten sind Arten, die „von Natur aus“ nicht in Deutschland vorkommen. Sie haben sich hier nicht selbst angesiedelt, stammen aus anderen Teilen der Welt und wurden durch menschliches Handeln (Transport, Infrastruktur, Handel mit Nutzpflanzen usw.) hierher gebracht. Viele nicht-heimische Arten sind wegen des Anbaus von Zier- oder Nutzpflanzen hierher gelangt.
Die Grenze zwischen nicht-heimisch und heimisch ist nicht immer eindeutig. Die Edelkastanie und die Walnuss stammen ursprünglich aus dem Mittelmeerraum und wurden in der Römerzeit gezielt nach Deutschland eingeführt. Sie sind bis heute verbreitet, gelten aber nicht als autochthon, da sie erst durch menschliche Einwirkung hierher gelangten. Gleichzeitig passen sie gut zu den deutschen Klimabedingungen und haben sich inzwischen so gut angepasst, dass manche sie ebenfalls als heimisch einstufen. Allgemein gelten Arten, die vor 1500 eingeführt wurden und sich seither gehalten haben, nicht als Exoten. Das Argument lautet, dass diese Arten – obwohl sie technisch gesehen durch menschliches Handeln hierher gelangt sind – letztlich auch aus eigener Kraft angekommen wären. Darüber wird fortlaufend diskutiert, daher hört man mitunter widersprüchliche Aussagen.
Was tun mit diesen exotischen Bäumen?
Verhalten: invasiv und expansiv
Arten können eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit haben – manchmal so stark, dass sie andere Arten verdrängen. In diesem Fall spricht man von expansivem oder invasivem Verhalten dieser Pflanzen.
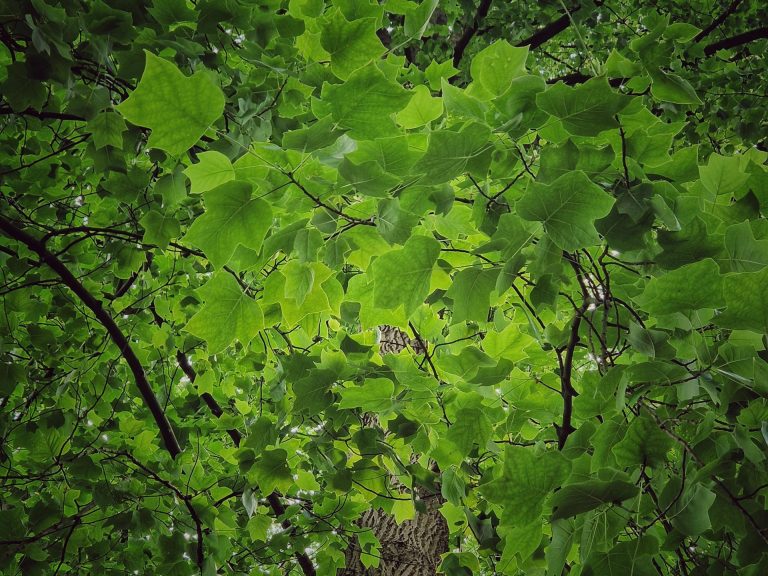
Wenn sich nicht-heimische Arten schnell ausbreiten, wird dieses Verhalten „invasiv“ genannt. Bei heimischen Arten spricht man dann von „expansivem“ Verhalten. Viele heimische Pionierarten (Birke, Weide, Pappel, Brombeere usw.) sind sehr expansive Arten: Sie verbreiten sich schnell und sind daher oft die ersten Bäume und Sträucher, die auftauchen, wenn man ein Stück (Land-)Fläche eine Zeit lang sich selbst überlässt.
Invasiv und expansiv beziehen sich beide auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit einer Art bis zu dem Punkt, an dem sie in einem Gebiet dominant wird. Für die Artenvielfalt ist eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit manchmal unerwünscht, weil sie die Gesundheit und Überlebenschancen bereits gefährdeter Arten und Ökosysteme weiter untergraben kann.
In einigen Publikationen wird daher der Unterschied zwischen invasivem und expansivem Verhalten anhand des Schadens definiert, den eine wuchernde Art in lokalen Ökosystemen anrichten kann. Invasive Arten sind dann per Definition auch schädlich, während expansive Arten sich zwar schnell verbreiten, aber grundsätzlich unschädlich für gefährdete Arten sind. Die Begriffe invasiv und expansiv sind dann nicht mehr an nicht-heimisch bzw. heimisch gekoppelt, sondern an die Schädlichkeit im Ökosystem. Deshalb liest man z. B. gelegentlich, der heimische Bergahorn, die Brombeere oder die Birke seien „invasiv“, obwohl diese Arten heimisch sind.
Im Folgenden verwenden wir den Begriff „invasiv“ als Kennzeichnung für Schädlichkeit, nicht zur Beschreibung der reinen Ausbreitungsgeschwindigkeit (lediglich) nicht-heimischer Arten. Mit expansivem Verhalten meinen wir eine hohe Ausbreitungsgeschwindigkeit, ohne damit automatisch Schädlichkeit zu implizieren.
Warum wird eine Art invasiv?
Eine Art wird invasiv, wenn sie in der (neuen) Umgebung einen großen oder unfairen Konkurrenzvorteil hat. Pflanzen konkurrieren um Raum, Licht und Nährstoffe. Wenn einer expansiven Art freie Bahn gelassen wird oder sie einen großen Vorteil in diesem Konkurrenzkampf hat, kann sie invasiv (schädlich) werden.
Ein „unfairer“ Konkurrenzvorteil kann z. B. sein, dass natürliche Feinde der Art nicht mit eingewandert sind. Wo die eine Art genug lokale Konkurrenten und Feinde hat, kann eine invasive Exotin dank der Abwesenheit solcher Gegenspieler das gesamte Ökosystem dominieren.
Ein Nährstoffüberschuss in der Umgebung ist ein weiterer Grund, warum eine bestimmte Pflanze übermäßig gut gedeihen kann. Das bekannteste Beispiel ist die Stickstoffkrise. Die dicke Stickstoffschicht, die seit mehr als fünfzig Jahren über Niederschlag (Regen, Schnee usw.) über unser Land verteilt wird, sorgt für einen Überfluss an Nährstoffen in ehemals nährstoffarmen (Natur-)Gebieten. Arten, die in nährstoffreichen Situationen bestens gedeihen, verdrängen nun die Arten, die eher auf nährstoffarme Böden angewiesen sind. So sehen wir heute überall wuchernde (heimische) Brombeeren, die sich rasant ausbreiten – oft auf Kosten anderer, langsamer wachsender Arten.
Wenn bestimmte Pflanzenarten ungehindert invasives Verhalten zeigen können, bleibt am Ende nur noch eine Handvoll Arten im Ökosystem übrig. Viele gefährdete Arten samt der zugehörigen Insekten, Tiersynergien und Funktionen verschwinden dann. Daher kann die Einführung oder Verbreitung invasiver Exoten eine Bedrohung oder nachteilige Folgen für Biodiversität, Wirtschaft und/oder Volksgesundheit darstellen.
Die Hauptursache für invasives Verhalten ist der allgemein niedrige Grad der Artenvielfalt und der schlechte Zustand unserer Ökosysteme. Wir haben Deutschland sehr eintönig gestaltet. Die meisten naturnahen Wälder in Deutschland wurden bis zum 19. Jahrhundert gerodet. Seither wurden viele Waldflächen vor allem zur Holzproduktion genutzt und entsprechend bewirtschaftet. Besonders seit der “Flurbereinigung” in den 1970er-Jahren und der Intensivierung der Landwirtschaft wurden immer mehr Monokulturen auf Land- und Forstwirtschaftsflächen eingeführt, wo kein Platz für Vielfalt war. Dies, kombiniert mit der Verstädterung, hat zum größten Biodiversitätsrückgang in Europa geführt (-85 % gegenüber vor 100 Jahren).
Gerät eine monotone Landschaft mit wenig Artenvielfalt durch z. B. Austrocknung und Stickstoffüberschuss unter Druck, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich bestimmte Arten schnell auf Kosten gefährdeter Arten verbreiten. Eine nicht-heimische Art, die von Natur aus expansiv ist, wird dann invasiv (schädlich). In einem gesunden und vielfältigen Ökosystem ist das Risiko solchen invasiven Verhaltens viel geringer, weil neue Arten durch natürliche Konkurrenz zahlreicher anderer, gesunder Organismen – Insekten, Pilze, andere Pflanzen – im Gleichgewicht gehalten werden.
Mit anderen Worten: Invasive Arten sind oft der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Sie schwächen Ökosysteme, aber sie konnten sich auch ansiedeln, weil das Ökosystem bereits geschwächt war. Die Bekämpfung eines Exoten kann also durchaus notwendig sein, ist jedoch oft Symptombekämpfung. Das eigentliche Problem liegt meist im Zustand des Ökosystems, das durch menschliches Zutun stark geschwächt wurde.
Invasiv bedeutet nicht überall invasiv
Arten werden invasiv, wenn sie einen (unfairen) Konkurrenzvorteil haben. Das kann jedoch auch ein temporärer Vorteil sein, wie der Stickstoffüberschuss. (Zumindest hoffen wir, dass dieser temporär ist und wir durch gute Agrarpolitik wieder zu normalen Werten gelangen.)
Invasives Verhalten kann auch sehr standortabhängig sein. Während sich die Roteiche auf sandigen Böden – etwa in Brandenburg oder Teilen Niedersachsens – so leicht ausbreitet, dass Naturschutzorganisationen vor ihrer Pflanzung warnen, gilt sie auf schweren, tonhaltigen Böden wie in Teilen Süddeutschlands oder des Rheinlandes als weniger problematisch: Dort breitet sie sich deutlich langsamer aus und wird bislang nicht als invasiv eingeschätzt. Bei der Frage, ob ein Baum oder Strauch invasiv ist, schaut man daher vor allem, wo er invasiv ist. Manche Pflanzen haben einen Vorteil auf sauren Böden, andere auf nassen Böden; einige Arten wuchern nur in offenen Landschaften mit viel Sonnenlicht.
Kann man invasives Verhalten vorhersagen?
Es ist daher schwierig vorherzusagen, wo und wann welche Exoten invasiv werden. Gerade bei Bäumen und Sträuchern kommt es häufig vor, dass sich eine Exotin zunächst kaum ausbreitet, später aber doch invasiv wird. Oder umgekehrt, dass eine Art, die sich anfangs stark invasiv verhält, durch Veränderungen im Ökosystem plötzlich weniger invasiv wird und sogar positive Beiträge zur lokalen Natur leistet. Siehe z. B. den gemischten Beitrag der Spätblühenden Traubenkirsche (Prunus serotina) – eine Art, die Mehr Bäume Jetzt zwar erntet, aber ausdrücklich nicht verteilt, weil sie invasiv ist.
Die Lösung heißt – wieder einmal – Artenvielfalt
Um widerstandsfähige und robuste Ökosysteme zu schaffen, die weniger anfällig für invasive Exoten sind, gewinnt der Ökosystemansatz an Bedeutung. Dieser Ansatz zielt darauf ab, reiche und gesunde Ökosysteme zu entwickeln, die sich selbst gegen das Wuchern eines Exoten wehren können. Das ist letztlich weniger zeit- und kostenaufwendig als die Bekämpfung von Exoten in einem stark geschwächten Ökosystem.
Beispiel: Die Spätblühende Traubenkirsche (Prunus serotina)
In Deutschland wurde diese Art einst als Füllholz in Wäldern angepflanzt, konnte sich aber aufgrund fehlender natürlicher Feinde und der einseitigen Waldzusammensetzung explosionsartig ausbreiten. Dadurch werden heimische Arten wie Eberesche und Eiche verdrängt, was zulasten der Artenvielfalt geht. Gleichzeitig beobachtet man jetzt, dass nach Jahrzehnten die Spätblühende Traubenkirsche mehr Insekten beheimatet als die heimische Traubenkirsche (Prunus padus).
Eine Studie von Schilthuizen et al. (2016) berichtete, dass sich die Zahl der blattfressenden Insektenarten auf Prunus serotina in den letzten 150 Jahren auf 69 verdoppelt hat, während sie auf Prunus padus niedriger liegt (39 Arten) und stabil blieb. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass die Dominanz der Spätblühenden Traubenkirsche abnimmt (Simberloff 2016). Dieses Phänomen zeigt vielmehr, dass die Natur ein großes Anpassungsvermögen besitzt. Nach Jahrhunderten oder länger werden sich immer mehr heimische Insekten und Pilze anpassen, und schließlich wird die Exotin ins Ökosystem integriert.
Es gibt Möglichkeiten, Risiken zumindest grob einzuschätzen. Man kann etwa auf die Entfernung und das Herkunftsökosystem blicken. Bei Arten aus anderen Teilen Europas ist es wahrscheinlicher, dass sie hier natürliche Feinde haben, als bei Arten aus Amerika oder Asien. Man kann auch schauen, ob das Herkunftsökosystem einem hiesigen Ökosystem ähnelt.
Warum verwendest du welche Art?
Jede Art hat ihre eigenen Vorteile – je nach einzigartiger Situation. Wir gehen sie gemeinsam mit dir durch.
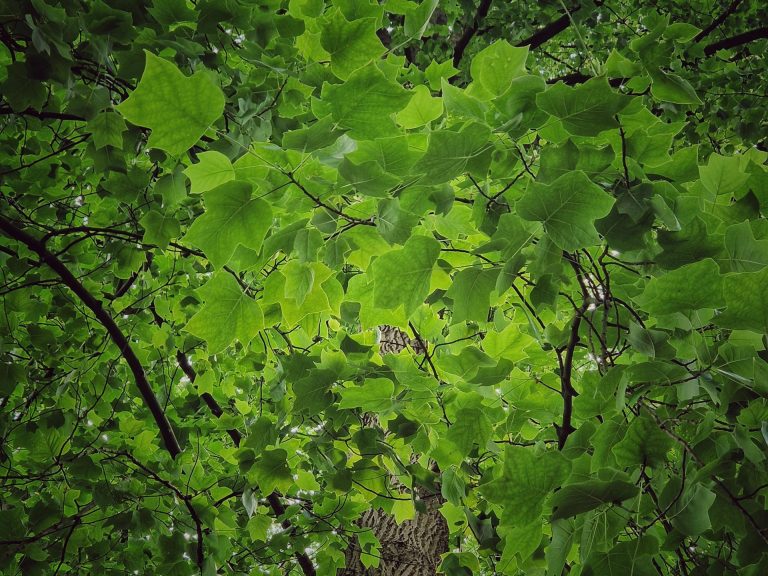
Warum (autochthon-)heimische Arten?
Autochthon-heimische Bäume sind Nachkommen der 1 % heimischen autochthonen Standorte, die sich seit der letzten Eiszeit hier vermehrt haben. Diese bedrohten Populationen spielen eine wichtige Rolle für spezialisierte Arten. In der Insektenwelt unterscheidet man zwischen Spezialisten und Generalisten. Die Generalisten – Insektenarten, die von vielen Quellen leben können – nutzen oft als Erste auch neu eingeführte Arten als Nahrungsquelle. Spezialisten hingegen haben sich auf eine bestimmte Nische entwickelt, z. B. eine spezielle Symbiose oder genau den einen Strauch, von dem sie zu einem bestimmten Zeitpunkt fressen. Solche langwierigen Beziehungen bestehen meist mit autochthonen Pflanzen. Die Nutzung autochthoner Arten bietet daher Vorteile für die Artenvielfalt und trägt zur Anpassungsfähigkeit von Ökosystemen bei.
Außerdem stellen autochthone Populationen eine Möglichkeit dar, mehr genetische Vielfalt (wieder) einzuführen. Viele Baumarten wurden mit nur wenigen Vorfahren angepflanzt, weil z. B. bestimmte Samen damals günstiger waren. Da der Großteil der deutschen Wälder in den letzten paar hundert Jahren angelegt wurde, ist die genetische Vielfalt entsprechend gering. Autochthone Populationen, die sich selbst vermehrt haben, bilden einen vielfältigen Genpool. Genetische Vielfalt ist ebenfalls eine Form von Biodiversität und sorgt für größere ökologische Widerstandskraft. Voraussetzung ist, dass man bei der (Wieder-)Einführung genetisch autochthonen Materials nicht erneut „wenige“ Vorfahren auswählt – Ziel ist Verbreiterung.
Warum heimische Arten?
Diese Baumarten kommen hier von Natur aus vor und vermehren sich leicht. Sie passen in dieses Gebiet. Heimische Baumarten sind an die klimatischen Bedingungen in Deutschland angepasst. Heimische (inklusive autochthone) Arten sind gut für die Artenvielfalt, weil sie bereits viele Verbindungen zu umgebenden Bäumen, Pflanzen, Insekten und Tieren aufgebaut haben. Sie bieten Nahrung und Lebensraum für verschiedene Organismen und ermöglichen so eine Vielfalt an weiterem Leben.
Je mehr Biodiversität, desto widerstandsfähiger das Ökosystem. Desto besser ist es gegen Krankheiten und Schädlinge, Klimawandel oder andere Umweltschwankungen gewappnet. Das Pflanzen heimischer Bäume und Sträucher, die die Biodiversität steigern und viele Verbindungen zur lokalen Natur knüpfen, bietet daher einen exponentiellen Vorteil: Jede neue heimische Art ermöglicht weiteres Leben. Die Eiche beherbergt über 1.000 Insektenarten – so viele wie kaum ein anderer Baum in Mitteleuropa. Auch die heimische Weide bietet mit etwa 400 Insektenarten wichtigen Lebensraum.
Warum nicht-heimische Arten?
Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten einen besonders hohen Verlust an Biodiversität erlitten – in manchen Artengruppen wie Insekten oder Feldvögeln bis zu 70 %. Das liegt deutlich über dem europäischen und globalen Durchschnitt. Schon vor der industriellen Revolution war Nordwesteuropa im Vergleich zu ähnlichen Klimazonen in Nordamerika und Asien relativ artenarm (vermutlich wegen der Auswirkungen der letzten Eiszeit). Angesichts des allgemein schlechten Zustands unserer Biodiversität kann jede Ergänzung eine Bereicherung sein.
Nicht-heimische Arten können einen positiven Beitrag zur Biodiversität leisten: Sie bringen eine neue Art, zusätzliche Vielfalt, ins Ökosystem. Sie können eine neue Nische, Rolle oder Aufgabe übernehmen und Aufgaben heimischer Arten unterstützen. Sie bieten Nahrung, Bestäubung, zahlreiche Versteck- und Nistmöglichkeiten und zusätzliche Resilienz gegenüber Wetterextremen sowie (möglichen neuen) Krankheiten und Schädlingen.
Störungen, denen eine heimische Art vielleicht nicht gewachsen ist, kann eine nicht-heimische Art möglicherweise abfedern – etwa im Hinblick auf den Klimawandel. Schon jetzt zeigt sich, dass viel Biodiversität verloren geht, weil sich viele Arten nicht schnell genug anpassen können. Dieses Problem wird verstärkt, weil viele unserer Naturschutzgebiete bereits besonders verletzlich sind, da sie gleichzeitig unter mehreren Stressfaktoren leiden. Es ist wahrscheinlich, dass große Teile Deutschlands in Zukunft ein Klima wie heute in Mittel- oder Südfrankreich haben werden. Deshalb richten viele Dendrolog*innen und Ökolog*innen ihren Blick gezielt auf diese Regionen, um geeignete Baumarten für die zukünftige Forstwirtschaft in Deutschland zu identifizieren. Ein weiteres Beispiel sind schwierige oder belastete Standorte im städtischen Raum.
Hinzu kommt, dass nicht-heimische Arten in unserer Gesellschaft viele wichtige Funktionen erfüllen: Die meisten Nutzpflanzen, von denen wir uns ernähren, sind nicht-heimisch. Viele Baumarten, die sich für nachhaltigen Bau eignen, sind ebenfalls nicht-heimisch– beispielsweise die Robinie (mehr dazu gleich).
Allerdings besteht ein Risiko: Durchschnittlich zeigt etwa 1 % der nicht-heimischen Arten invasives Verhalten. Gleichzeitig zeigt sich, dass viele heimische Insekten, Vögel und andere Tiere sich im Laufe der Zeit an neue nicht-heimische Arten gewöhnen, sodass die Zahl der Verbindungen zwischen nicht-heimischer Flora und heimischer Flora und Fauna rasch zunimmt. Die entstandenen Beziehungen zwischen der Spätblühenden Traubenkirsche und diversen heimischen Insekten sind ein gutes Beispiel.
Trotzdem ist eine sorgfältige Einführung von Arten sehr wichtig: Der Anteil nicht-heimischer Arten, der invasiv wird, ist zwar niedrig, aber die Auswirkungen der Arten, die doch invasiv werden, sind in unseren bereits geschwächten Ökosystemen groß.
Die Robinie – Vor- und Nachteile
Blütenbesucher akzeptieren unbekannte Blüten meist recht problemlos (Nektar ist Nektar), doch Blattfresser wie Raupen haben oft Probleme mit unbekanntem Blatt. Exoten können schließlich das Ökosystem mit weitreichenden Effekten verändern. Die Robinie zeigt vor allem auf mageren Sand- oder Kalkgrasländern invasives Verhalten und kann offene Flächen mit ihren Wurzelausläufern übernehmen. Dieselbe Robinie liefert aber hochwertiges Hartholz und kann in Agroforstprojekten als Stickstoffbinder dienen – das hilft der umgebenden Vegetation. Die allermeisten Baum- und Pflanzenarten, von denen wir essen, sind nicht-heimisch. So haben viele nicht-heimische Pflanzen und Bäume eine Rolle in einem nachhaltigen Ernährungssystem und nachhaltigen Bauen.
Mehr Bäume Jetzt: sowohl-als-auch, nicht entweder-oder
Für uns lautet die Diskussion nicht „Exoten – ja oder nein?“, sondern vielmehr: Tragen die Arten, die du in diesem Kontext pflanzt, zu einer Bereicherung bei? Exoten in der Nähe alter autochthoner Bestände werden mehr Artenvielfalt vernichten, als dass sie hinzufügen; andererseits hat die Umwandlung eines alten Maisackers in einen Waldgarten (voller Exoten) gezeigt, dass er mehr Vielfalt aufweist als das benachbarte Naturschutzgebiet.
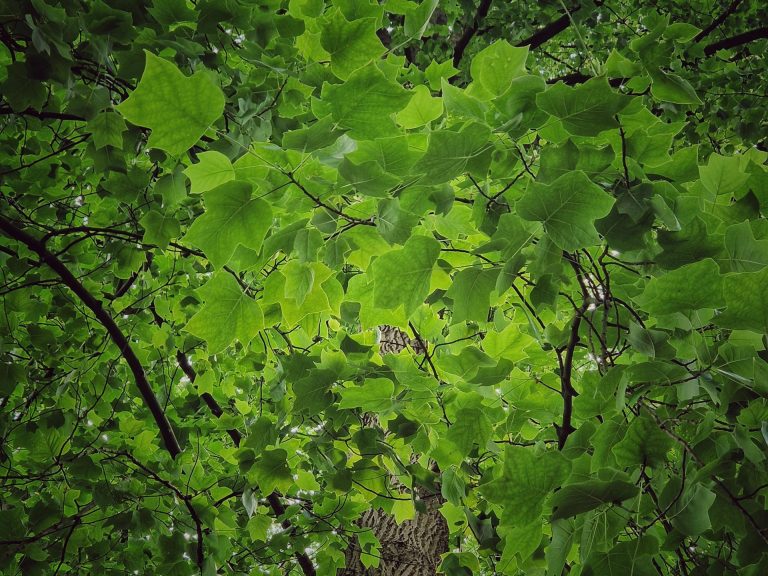
Auf welcher Grundlage treffen wir unsere Entscheidungen?
Mehr Bäume Jetzt verteilt in der Regel hauptsächlich heimische Jungbäume. Diese sind am stärksten in Überzahl in den Erntegebieten, tragen erheblich zur Artenvielfalt in Deutschland bei – insbesondere wenn man sie mit heimischen Kräutern und anderen Stauden kombiniert. Ob diese Bäume auch autochthon-heimisch sind, lässt sich schwer feststellen. Doch was machst du mit nicht-heimischen Bäumchen, wenn du sie dennoch erntest oder bekommst?
In der gesellschaftlichen Debatte über Exoten, wie oben dargelegt, vertritt Mehr Bäume Jetzt den Standpunkt, dass sowohl heimische als auch nicht-heimische Arten verschiedene positive Beiträge zur Erholung von Natur und Biodiversität in Deutschland leisten können. Es kommt vor allem darauf an, wo sie gepflanzt werden.
Deutschland braucht mehr Artenvielfalt und damit auch mehr Bäume und Sträucher (und andere Pflanzen). Das bedeutet mehr Wald, aber auch mehr Vielfalt im übrigen Landschaftsbild. Das bedeutet: mindestens 10 % grün-blaue Vernetzung (vgl. Deltaplan), mehr Bäume und Sträucher in Städten gegen Hitzestress, Bäume als Schutz vor Klimadepressionen, pflanzliche Strukturen entlang von Straßen und Bahnlinien zur Feinstaubbindung, Hecken, Knicks und Wallhecken in der Agrarlandschaft, Agroforstsysteme und Waldgärten in der Landwirtschaft – und deutlich mehr Vielfalt in der Forstwirtschaft.
Wo geschwächte Wälder und Naturschutzgebiete – insbesondere seltene autochthone Populationen – noch vorhanden sind, ist es enorm wichtig, diese zu schützen und zu erweitern. Direkt rund um alte Bestände ist es daher sinnvoll, ausschließlich mit autochthonem Pflanzmaterial zu arbeiten – dort bringt das den größten Nutzen.
Ein weiterer Ring davon entfernt bietet heimisch die beste Lösung – gemeint ist das ländliche Gebiet und Landschaftselemente. Gehst du noch weiter hinaus – Landwirtschaft und städtischer Bereich, wo ohnehin mehr Störungen stattfanden und weiter stattfinden werden, du also von einer viel niedrigeren Ausgangsbiodiversität startest und die Bepflanzung zusätzliche Funktionen haben muss –, ist eine Kombination das logischste. Die Landwirtschaft beansprucht 60 % unserer Landfläche und ist mit Kilometern an Monokultur äußerst artenarm. Die Kombination aus heimischen und nicht-heimischen Arten bietet hier eine Chance. Und eine Vielfalt an (landschaftlichen) Systemen mit einer Vielfalt an heimischen und nicht-heimischen Arten, idealerweise noch mit etwas genetischer Variation im Mix, kann den größten Unterschied machen. Eines schließt das andere nicht aus, solange du Vielfalt hinzufügst.
Darum kommt unseren Niederländische Partner Urgenda mit einer Bodennutzungsvision Land in Sicht – siehe hierzu das Video:
Die Totholzhecke
Bäume und Sträucher, die du nicht verschenken möchtest, kannst du manchmal in einer Totholzhecke verarbeiten. So tragen sie trotzdem zur Biodiversität bei! Schau dir das Video unten an, um zu sehen, wie man eine solche Hecke anlegt.
Über Exoten
Unsere Leitlinie für die Pflanzung nicht-heimischer Arten lässt sich daher zusammenfassen als: „Ja, nut unter bestimmten Bedingungen!“. Mit anderen Worten: Ja, wir geben auch nicht-heimische Arten zur Pflanzung in anderen Gebieten aus, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind.

Bedingung 1: Halte dich an Gesetze und Vorschriften sowie die allgemeinen Bedingungen
Bestimmte (invasive) Exoten dürfen nicht verbreitet werden. Diese Arten stehen auf der EU-Liste der Europäischen Verordnung über invasive gebietsfremde Arten (1143/2014).
Dies ist auch in unseren allgemeinen Bedingungen für jeden Pflanzstandort festgehalten.
Bedingung 2: Vorsicht in der Nähe sensibler Gebiete
In der Nähe von (empfindlichen) Naturschutzgebieten ist es wichtig, vorsichtig mit gebietsfremden Arten umzugehen, die sich möglicherweise invasiv verhalten können. Behörden und Naturschutzorganisationen verfügen in der Regel über eine Übersicht, um welche Gebiete es sich handelt. Generell ist es ratsam, einen Abstand von bis zu 15 Kilometern zu solchen Gebieten einzuhalten, wenn man gebietsfremde Arten in einem Waldgarten- oder Agroforstprojekt verwenden möchte.
Bedingung 3: Pflanze dort, wo der Baum den größten Mehrwert hat
Pflanze die Art, die an der jeweiligen Pflanzfläche die größtmögliche Bereicherung bringt. Untersuche die Umgebung, in der du pflanzen willst: Handelt es sich um eine Monokulturlandschaft oder bist du z. B. in der Nähe eines Natura-2000-Gebiets? Was ist also deine Ausgangssituation? Welches Ökosystem willst du schaffen und welche Funktionen soll es erfüllen?
Bald hoffen wir, dir dabei weiterhelfen zu können. Wir entwickeln derzeit nämlich den Baumfinder: Du kreuzt an, was du pflanzen möchtest und welche Funktionen die Bäume und Sträucher erfüllen sollen – und der Baumfinder gibt dir eine Empfehlung, was am besten zu dir passt. Nicht-einheimische Arten werden nur dann im Ergebnis angezeigt, wenn du Agroforstwirtschaft oder Gärten auswählst.
Totholzriegel
Bäume und Sträucher, die Sie nicht weitergeben möchten, können Sie stattdessen in einer Totholzhecke (Totholzriegel) nutzen. Dadurch leisten sie trotzdem einen wertvollen Beitrag zur Biodiversität!
Discussie soorten
Bij Meer Bomen Nu krijgen we regelmatig de vraag hoe we omgaan met soorten die mogelijk een invasief karakter hebben: “Kunnen we zulke soorten uitdelen of juist niet?” Op deze pagina bieden we jullie inzage over onze afwegingen m.b.t. deze soorten.

invasieve soorten en discussie soorten
Rond bepaalde soorten gaan geruchten de ronde dat ze invasief zouden zijn. Echter, dergelijke beweringen zijn lang niet altijd gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Als organisatie hechten we veel waarde aan feiten. Daarom hanteren wij een terughoudende houding tegenover aannames over invasiviteit, tenzij er wetenschappelijk bewijs is dat dit aantoont.
Alleen wanneer er langjarig, deugdelijk onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse omstandigheden en dit onderzoek onomstotelijk aantoont dat een soort invasief is, erkennen wij deze als zodanig. Tot die tijd blijven wij openstaan voor het gebruik van soorten, zolang ze bijdragen aan onze missie: het vergroten van biodiversiteit en het ondersteunen van een veerkrachtig ecosysteem.
Lees hieronder welke richtlijnen wij hanteren voor soorten die niet per definitie invasief zijn, maar wel een mogelijk invasief karakter hebben. Het aanmoedigen van deze soorten is hierbij nooit aan de orde, maar eerder de afweging wat een veilige plek zou kunnen zijn in geval dat ze tussen je oogst zitten.
Soorten met een ?
Amerikaanse eik (Quercus rubra)
De Amerikaanse eik komt uit het oosten van Noord-Amerika en is snelle groeier met een grote concurrentiekracht. De soort werd sinds 1825 gebruikt als sierboom en vervolgens ook voor aanplant van bossen op grote schaal. Met name op droge arme zandgronden gedraagt de Amerikaanse eik zich invasief en verdrukt daardoor inheemse soorten, zoals de inlandse eik en Grove den. De soort heeft een brede en dichte kroon en slecht verterend blad waardoor andere bomen niet kunnen ontkiemen en ondergroei geremd wordt.
Advies rapport ‘Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry‘ (WUR 2022) geeft aan dat aanplant van deze soort ongewenst.
Richtlijn Meer Bomen Nu: We gaan mee in de bovenstaande richtlijn. Dit betekent wel oogsten van Amerikaanse eik om te verwijderen, maar niet herplanten.
Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina)
Amerikaanse vogelkers is een licht behoevende pionier boomsoort die in de jaren twintig van de vorige eeuw in Nederland werd geïntroduceerd. In houtwallen, bosranden en open bossen ontstaat vaak een dominerende Amerikaanse vogelkers struiklaag die dus andere lichtminnende inheemse vegetatie verdrukt. De soort wordt daarom ook wel bospest genoemd.
Advies rapport ‘Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry‘ (WUR 2022) beschrijft dat aanplant van Amerikaanse vogelkers ongewenst is.
Richtlijn Meer Bomen Nu: We houden bovenstaande advies aan. Verwijderen van Amerikaanse vogelkers is wenselijk, herplanten van Amerikaanse vogelkers niet.
Anna palowna boom (Paulownia tomentosa)
De Anna palowna boom komt oorspronkelijk uit China en is een pioniersoort die snel groeit en makkelijk worteluitlopers maakt. Het is een van de meest productieve houtsoorten en wordt daarom in Europa veel aangeplant. De boom produceert veel zaden die worden verspreid door de wind en kunnen wel kilometers ver komen. Door zijn snelle groeikracht kan de mooi snel dominant worden in verstoorde milieus. Hij staat op de lijst van de Global Invasive Species Database (GISD), maar wordt in Nederland (nog) niet als volledig invasief bestempeld. De verwachting is wel dat de soort in de toekomst problemen kan gaan geven zoals in de rest van Europa.
Advies rapport ‘Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry‘ (WUR 2022) adviseert aan de soort niet aan te planten.
Richtlijn Meer Bomen Nu: We adviseren terughoudendheid met betrekking tot de Anna Palownaboom. We zijn ons bewust van het gebruik van deze boom in het groeien van hoogwaardig en duurzaam hout. We verwachten dat het risico van deze boom beperkt is in agroforestry systemen of tuinen, desalniettemin raden we deze boom niet aan voor herplant.
Canada populier (Populus canadensis)
De Canadapopulier kan zich snel verspreiden langs waterwegen en andere geschikte habitats. Omdat de soort een verdringingseffect heeft op de inheemse zwarte populier, kan de Canadapopulier een risico vormen voor de biodiversiteit. Dat wordt aangetoond in dit onderzoek waarin de steriele Canadapopulier plots wel in grote mate kiemkrachtige zaden kan voortbrengen wanneer het bestoven wordt met een mengsel van eigen stuifmeel en soortvreemd stuifmeel van de Zwarte populier. Het risico op verspreiding van exotische genen door Canadapopulier kan dus sterk beperkt worden door aanplant in de omgeving van de Zwarte populier te vermijden.
Rapport ‘Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry‘ (WUR 2022) geeft aan dat aanplant mogelijk is.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Wij oogsten en planten de Canadese populier. Plant Canadese populier niet in de buurt van Zwarte populieren.
Laurierkers (Prunus laurocerasus)
In de veldgids van de NVWA wordt de Laurierkers als invasief bestempeld, omdat de soort de inheemse soorten verdringt door snelle vermeerdering van worteluitlopers en veel licht kan wegnemen.
Advies rapport Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry (WUR 2022): aanplant van deze soort ongewenst.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Plant een Laurierkers alleen aan in tuinen. Plant niet binnen een straal van 5 km van Natura 2000 gebied. Zo beperken we de kans dat Laurierkersen in natuurgebieden gaan groeien.
Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia)
De Kaukasische vleugelnoot vormt veel worteluitlopers en wordt daarom ook wel is als mogelijk invasieve soort gezien.
Tot dusver wordt de soort niet als invasief bestempeld.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Plant de Kaukasische vleugelnoot niet aan binnen een straal van 5 km van Natura 2000 gebieden.
Lijsterbesspirea (Sorbaria sorbifolia)
In de veldgids van de NVWA wordt aangegeven dat de Lijsterbesspirea lange wortel uitlopers kan vormen en zo de ondergroei kan domineren.
Advies rapport Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry (WUR 2022): aanplant van deze soort ongewenst.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Plant een Lijsterbesspirea alleen aan in tuinen. Plant de soort niet binnen een straal van 5 km van Natura 2000 gebied. Zo beperken we de kans dat Lijsterbesspirea’s in natuurgebieden gaan groeien.
Prachtframboos (Rubus spectabilis)
De veldgids van de NVWA geeft aan dat de Prachtframboos sterk invasief is in relatief droge elzenbroekbossen op veengrond en daar de ondergroei dominerend.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Wij oogsten en planten van Prachtframboos. Plant gelieve niet binnen straal van 5 km van Elzenbroekbos als je weet dat dit habitattype in je buurt ligt.
Rode ribes, siertrosbes (Ribes sanguineum)
De NVWA veldgids vermeld dat de Rode ribes voornamelijk goed in de duinen groeit en daar ook invasief gedrag vertoont door inheemse soorten te verdringen.
Advies rapport Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry (WUR 2022): aanplant van deze soort ongewenst.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Plant Rode ribes niet binnen een straal van 5 km van de duinen.
Valse acacia (Robinia pseudoacacia)
De Valse Acacia is een pionierssoort en zeer concurrerend in droge en zonnige milieus. De soort groeit erg snel en vormt veel worteluitlopers, maar verspreidt niet over grote afstanden.
Daarnaast is de Valse acacia een vlinderbloemige en verrijkt de bodem met stikstof, waardoor de bodemeigenschappen en de botanische compositie van droge milieus gewijzigd wordt.
AlterIAS-project vermeld dat de soort in verscheidene Europese landen (België, Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Hongarije) als invasief wordt beschouwd.
Aanbevelingen AlterIAS project:
- Vermijd de aanplant van deze soort in de nabijheid van droge, rotsachtige milieus, in het bijzonder in de buurt van beschermde sites (natuurgebieden, Natura 2000 sites, enz.).
- Plaats bij aanplant een rhizoombegrenzer om de laterale groei te beperken.
Advies rapport Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry (WUR 2022): geef aan dat de Valse acacia nauwelijks risico vormt voor invasiviteit en aangeplant kan worden.
Advies Meer Bomen Nu: Wij oogsten en planten de Valse acacia. Liefst niet binnen een straal van 5 km van Natura 2000 gebieden.
Vlinderstruik (Buddleja davidii)
De Vlinderstichting zegt het volgende over de Buddleja : ‘In Nederland zijn er voor zover ons bekend, geen voorbeelden van het invasieve karakter, maar dat kan een kwestie van tijd zijn.’ In Nederland is deze nog niet aangemerkt als invasief, maar wel wordt afgeraden de Vlinderstruik nabij natuurgebieden te planten.
Naast het mogelijk invasieve karakter is de Vlinderstruik een soort snackbar voor vlinders omdat de plant snelle suikers biedt, maar geen waardplant is voor hun nakomelingen. Wil je de biodiversiteit versterken? Plant dan ook inheemse soorten aan.
Rapport ‘Richtlijnen voor risicobeperking invasieve exoten in agroforestry‘ (WUR 2022) geeft aan dat aanplant van deze soort ongewenst is.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Plant een vlinderstruik alleen aan in tuinen. Indien je voorzichtig wilt zijn, plant dan ook niet binnen een straal van 5 km van Natura 2000 gebied. Zo beperken we de kans dat Vlinderstruiken in natuurgebieden gaan groeien.
Witte abeel (Populus alba)
De Witte abeel staat niet op NVWA unielijst als invasief. Verder zijn er weinig bronnen op internet te vinden die aantonen dat Witte abeel invasief is. Hij staat wel als invasief op deze lijst van Natuur en Milieu, maar niet terug te vinden vanuit welk onderzoek.
Richtlijn Meer Bomen Nu: Wij oogsten en planten de Witte abeel.
Bomenencyclopedie
Wil je weten welke boom en/of struik bewezen invasief, uitheems of inheems is? Neem dan een kijkje in onze Bomenencyclopedie.
Natura 2000 gebieden
Alle Natura 2000 gebieden worden in kaart gebracht. Woon je in de buurt van een Natura 2000 gebied? Dan is extra voorzichtigheid geboden met uitheemse soorten. Bekijk de kaart hieronder.
